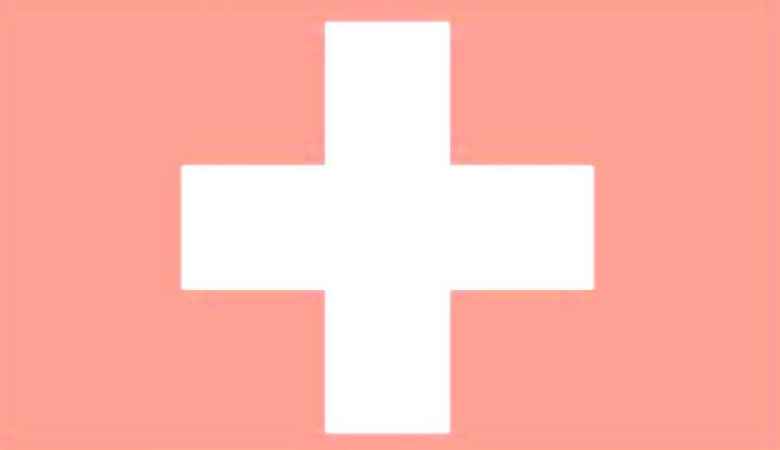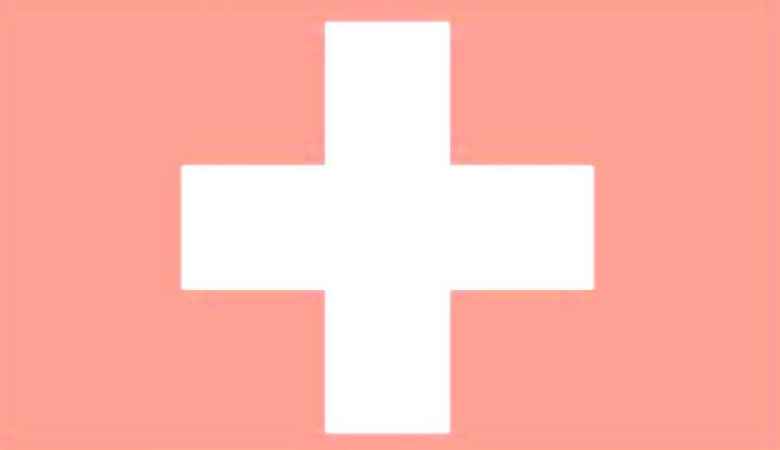|
Literatur |
Gauch, Peter -
Über die Ausbildung der Juristen,
Richter und Verfahrensrecht, Bern 1991, S. 123ff; Häberle, Peter, Juristische Ausbildungszeitschriften
in Europa, ZEuP 2000, 263; du Pasquier, Shelby, Formation et globalisation: un
nouveau défi pour le juriste suisse, Zeitschrift für schweizer Recht, 2000,
437; Schneider, Hildegard, Die Ausbildung zum Juristen:
eine rechtsvergleichende Übersicht;
In der Schweiz ist die Rechtspflege wie das Hochschulwesen Sache der 26 Kantone, die jeweils
selbständige Regelungen erlassen. Diese sind aber relativ ähnlich ausgestaltet,
so dass sich diese Darstellung auf die Juristenausbildung und
Berufszugangsvoraussetzungen der Hauptstadt Bern und ihrer Universität
beschränken kann.
 |
Hochschulstudium
Zugangsvoraussetzung für das Studium an Schweizer Hochschulen ist ein so
genannter Vorbildungsnachweis, also in erster Linie eidgenössische Maturitäten,
was dem deutschen Abitur gleichsteht. Daneben gibt es aufgrund der kantonalen
Besonderheiten eine ganze Liste weiterer anerkannter Vorbildungen, wie
Fachhochschulabschlüsse oder Abschlüsse bestimmter weiterer Schulformen. Auch
ausländische Schulabschlüsse werden anerkannt, sofern sie als allgemeinbildend
gelten, was für das deutsche Abitur der Fall ist. Die Kriterien im
einzelnen finden Sie unter diesem
Link.
Auch die Schweiz ist dabei ihr Studium dem Bologna-Modell anzupassen und in
diesem Jahr wurde auch für Jura das System von Bachelor und Master eingeführt.
Am Anfang steht das Einführungsstudium von zwei Semestern, das die Grundlagen in
Zivil-, Straf- und öffentlichem Recht, sowie juristische Arbeitstechnik
vermitteln soll. Darauf folgt das Hauptstudium, in dem zwei Jahre lang diese
Kenntnisse vertieft werden und die so genannten Grundlagenfächer unterrichtet
werden. Die Studenten müssen dabei nach Wahl zwei dieser Fächer besuchen, die
aus dem Bereich der Rechts- und Staatstheorie, der Rechtsgeschichte und des
römischen Rechts stammen.
Das Masterstudium ist dann ein reines Wahlfachstudium mit einer
Regelstudienzeit von drei Semestern. Die Studierenden können aus einem großen
Katalog ihre Fächer frei zusammenstellen, wobei zwischen 78 und 90 ECTS Punkte
erreicht werden müssen. Bis zu einem Umfang von 24 ECTS Punkten dürfen darunter
auch fakultätsfremde Fächer sein. Außerdem muss eine Masterarbeit geschrieben
werden, die innerhalb von 12 Wochen nach Ausgabe des Themas eingereicht werden
muss. Einen Master mit Schwerpunktzertifikat bekommt man, wenn man bei seiner
Fächerauswahl mindestens 48 ECTS Punkte in einem Schwerpunktbereich wählt und
seine Masterarbeit in diesem Bereich schreibt.
Link:
Studienplan
für Bachelorstudium an der Uni Bern;
Studienplan
für Bachelorstudium an der
Uni Basel;
Studienplan
für Bachelorstudium an der Uni
Fribourg;
Studienplan für
Bachelorstudium an der Uni Zürich;
Studieninfo für Masterstudium an der Uni Bern;
Studieninfo für Masterstudium an der
Uni Basel;
Studieninfo für Masterstudium an der Uni
Fribourg;
Das Bachelor-Studium dauert sechs Semester, das Master-Studium weitere drei
Semester.
Es finden vorwiegend klassische Vorlesungen statt, bei denen teilweise die
Anwesenheit durch Testat belegt werden muss. Daneben gibt es
Übungsveranstaltungen, die einerseits im ersten Studienjahr vorlesungsbegleitend
stattfinden, dann aber auch im letzten Studienjahr des Bachelor-Studiums zu einem
großen Teil den Platz der Vorlesungen einnehmen. Zu diesem Zeitpunkt findet dann kaum noch
Stoffvermittlung statt, sondern es steht die Einübung von Fallbearbeitung und
Klausurenübung im Vordergrund.
Am Ende des ersten Studienjahres müssen jeweils eine schriftliche Prüfung in
Privatrecht, Strafrecht und öffentlichem Recht abgelegt werden. Dabei werden wie
in Deutschland Fallklausuren gestellt. In Bern müssen während des Hauptstudiums zudem
zwei "Falllösungen" eingereicht werden, die den deutschen Hausarbeiten
entsprechen. Außerdem muss ein Seminar besucht werden, das aus einem mündlichen
Referat mit schriftlicher Zusammenfassung besteht, die allerdings nicht dem
Umfang einer deutschen Seminararbeit entspricht. In Basel dagegen wird während
des Bachelor-Studiums (3.-6. Semester) in jedem Fach eine Klausur geschrieben,
durch die man die Kreditpunkte des Faches erwirbt.
Im Masterstudium wird in jedem einzelnen der gewählten Fächer am Ende der
Lehrveranstaltung eine Prüfung abgehalten, und zwar entweder als zweistündige
schriftliche Prüfung oder als 20-minütige mündliche Prüfung.
Beispielklausuren:
Übungsfall Handelsrecht;
Übungsfall Privatrecht;
Übungsfall öffentliches Recht;
Credit-Prüfung Strafrecht;
Credit-Prüfung im römischen Recht
Am Ende des Hauptstudiums müssen je eine fünfstündige Klausur in Zivilrecht,
Strafrecht und öffentlichem Recht abgelegt werden, sowie eine vierstündige
Fachprüfungen im Wirtschaftsrecht und eine in den so genannten Grundlagenfächern
(während des Studiums belegte Wahlfächer). Die Gesamtnote für das Studium ergibt
sich aus aus den genannten Prüfungen, die jeweils doppelt zählen und den während
des Studiums erzielten Ergebnissen in den beiden Falllösungen und dem Seminar.
In der Schweiz gibt es die Ausbildungszeitschrift "recht",
die sechsmal im Jahr erscheint. Allerdings beträgt die Auflage nur 1940
Exemplare, so dass sie wohl nicht zur gängigen Lektüre der Studenten zählen
dürfte.
Während des Bachelor-Studiums reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten auf die
Grundlagenfächer, die jeweils eine Veranstaltung im 3. und 4. Semester
ausmachen. Dafür besteht im Master-Studium praktisch völlige Wahlfreiheit aus
einem Katalog von über 90 Fächern. Die Studierenden können Fächer aus den
Schwerpunktbereichen Grundlagenfächer, Privatrecht, Strafrecht, öffentliches
Recht und Wirtschaftsrecht frei miteinander kombinieren.
Während des Bachelor-Studiums gibt es kaum Bezüge zum Ausland, lediglich
Grundzüge des Völkerrechts werden unterrichtet. Im Masterstudium gibt es dafür
ein eigenes Schwerpunktzertifikat "Internationales und europäisches Recht"
und zahlreiche Veranstaltungen mit internationalem Bezug.
Die Universität Bern empfiehlt Studenten einen Auslandsaufenthalt während des
Masterstudiums. Im Ausland erbrachte Studienleistungen werden bis zu einem
Umfang von 45 ECTS Punkten auf das Masterstudium angerechnet. Hier ist also
problemlos ein Auslandsaufenthalt ohne Zeitverlust möglich.
Allerdings gibt es an der Universität Lausanne einen
Lehrstuhl für deutsches Recht, an dem auch der deutsche große Schein im
bürgerlichen Recht erworben werden kann, der an allen Fakultäten in Deutschland
anerkannt wird.
Link: Lehrstuhl für
deutsches Recht Lausanne
Während des Studiums müssen keine Praktika abgelegt werden.
|
 |
Vertiefungsstudien |
An den Bachelor kann man in der Schweiz ein Master-Studium als reines Wahlfachstudium mit einer
Regelstudienzeit von drei Semestern anschließen. Die Studierenden können dort aus einem großen
Katalog ihre Fächer frei zusammenstellen, wobei zwischen 78 und 90 ECTS Punkte
erreicht werden müssen. Bis zu einem Umfang von 24 ECTS Punkten dürfen darunter
auch fakultätsfremde Fächer belegt werden. Außerdem muss eine Masterarbeit geschrieben
werden, die innerhalb von zwölf Wochen nach Ausgabe des Themas eingereicht werden
muss. Einen Master mit Schwerpunktzertifikat erlangt man, wenn man bei seiner
Fächerauswahl mindestens 48 ECTS Punkte in einem Schwerpunktbereich wählt und
seine Masterarbeit in diesem Bereich schreibt.
Wer den Master mit mindestens der Note 4,75 (von 6) besteht, hat zudem die
Möglichkeit, durch die Anfertigung einer Dissertation den Grad eines Doctor iuris
zu erlangen.
 |
Berufszugang
In der Schweiz stellt der Universitätsabschluss noch nicht die
Zulassungsberechtigung für die juristischen Berufe dar. Vielmehr muss für
jeden Beruf noch eine gesonderte Prüfung abgelegt werden.
Auch die Regelung der Anwaltschaft ist der Schweiz Sache der
Kantone, so dass es 26 verschiedene Zulassungsvorschriften gibt. Es gibt sogar
die verschiedensten Bezeichnungen für den Beruf wie Rechtsanwalt (Zürich),
Advokat (Basel) oder Fürsprecher (Bern). Ein Anwaltspatent wird dementsprechend
auch nur für einen Kanton erteilt, wobei allerdings ein Anspruch auf Zulassung
in anderen Kantonen besteht, sofern die dortigen weiteren
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Aus Platzgründen muss sich diese
Darstellung auf die Zulassung zum Fürsprecher im Kanton Bern beschränken.
Zunächst muss eine praktische Ausbildung (vergleichbar dem
Referendariat) absolviert werden, zu der jeder zugelassen ist, der einen
schweizerischen Juraabschluss hat. Die Ausbildung dauert 18 Monate, wovon
mindestens neun in einer Anwaltskanzlei und mindestens drei bei einem Gericht
abgeleistet werden müssen. Die Präsenzzeit am Arbeitsort sollte dabei 32 Stunden
nicht unterschreiten.
Am Ende der praktischen Ausbildung steht die
Fürsprecherprüfung, zu der zugelassen wird, wer neben dem Abschluss in Jura auch
nachweisen kann, Lehrveranstaltungen in Rechtsmedizin, gerichtlicher
Psychiatrie, Kriminologie und Anwaltsrecht, sowie einen Buchhaltungskurs besucht
zu haben. Außerdem dürfen keine einschlägigen Vorstrafen vorliegen.
Die Prüfung besteht einerseits aus einem schriftlichen Teil,
der die Abfassung eines Urteils oder einer Prozessschrift 1. in einem Fall aus
dem Staats-, Verwaltungs- oder Steuerrechts, 2. in einer Strafsache und 3. in
einer Zivilrechts- oder Schuldbetreibungs- und Konkurssache zum Gegenstand
hat. Dabei dauert die Strafrechtsprüfung acht Stunden, die übrigen Prüfungen
jeweils sechs Stunden. Außerdem gibt es jeweils eine zwanzigminütige mündliche
Prüfung in 1. Staats- und Verwaltungsrecht, 2. Strafprozessrecht, 3.
Zivilprozessrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 4. Steuerrecht. Der
dritte Teil der Prüfung ist ein zehnminütiger Probevortrag, der einen
praktischen Fall aus dem Gebiet des Zivil- oder Strafrechts zum Gegenstand hat,
wobei die Akten den Kandidaten erst am Tage des Probevortrags eröffnet werden.
Link:
Verordnung über die Fürsprecherprüfung
In der öffentlichen Verwaltung finden sich Juristen an
zahlreichen Stellen. Fast jede Behörde hat eine juristische Abteilung, die
häufig mit studierten Juristen besetzt sind. Der Zugang erfolgt durch Bewerbung
auf einzelne Stellen, die sowohl auf Bundesebene als auch auf
Kantonsebene laufend in Stellenmärkten ausgeschrieben werden und jeweils
unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikationen setzen.
Link:
Zentrale Seite der
Schweizerischen Verwaltung mit Links auf die Kantone
In der Schweiz gibt es drei Instanzen, auf Kantonsebene die
Amts-/Bezirksrichter und die Ober-/Appellationsrichter und auf Bundesebene das
Bundesgericht in Lausanne. Der Zugang zu den verschiedenen Ebenen ist recht
unterschiedlich gestaltet.
Die erstinstanzlichen Richter werden in vielen Kantonen durch
Volkswahl bestimmt. In den meisten Kantonen müssen die Bewerber auf die
Richterämter keinen juristischen Abschluss besitzen. In kleineren Kantonen ist
daher das Laienrichtertum sehr ausgeprägt. In größeren Kantonen werden
allerdings vornehmlich Juristen in das Richteramt gewählt.
Die Richter der zweiten Instanz werden in einigen Kantonen
durch das Kantonsparlament, in anderen durch das Volk gewählt. Auch hier werden
häufig nur politische Rechtsfähigkeit, Mindestalter, Sprachkompetenz und
Wohnsitz im Wahlkreis verlangt. Eine juristische Ausbildung wird kaum
vorausgesetzt und nur in vier Kantonen müssen die Richter der zweiten Instanz
Jura studiert haben. Stattdessen hat sich zum wichtigsten Auswahlkriterium die
Parteimitgliedschaft und die politische Aktivität entwickelt.
Die Bundesrichter werden in der Schweiz durch die vereinigte
Bundesversammlung gewählt und müssen alle drei Sprachen beherrschen sowie die
politische Rechtsfähigkeit besitzen. Eine juristische Vorbildung wird selbst auf
dieser Ebene nicht zwingend vorgeschrieben, wobei in der Praxis allerdings nur
erfahrene Juristen gewählt werden.
Link: Zentralschweizer Richtervereinigung
Auch das Notariat liegt in der Schweiz in der Kompetenz der
Kantone, die es sehr unterschiedlich ausgestalten. Teilweise gibt es überhaupt
keinen gesonderten Notarberuf und die klassischen Notaraufgaben werden Richtern,
Gerichtsschreibern, Gemeindeschreibern, Gemeindepräsidenten, Zivilstandsbeamten
oder Grundbuchverwaltern übertragen. In den Kantonen Aargau, Basel-Stadt,
Bern, Solothurn, Uri und Wallis ist dagegen das Notariat ein eigenständiger
Beruf mit eigenem Patent und eigener Prüfung. In Glarus, Graubünden, Luzern, St.
Gallen, Schwyz und Zug wird das Notariat auf einen patentierten Anwalt
übertragen. In Thurgau und Zürich wird der Notar durch das Volk als öffentlicher
Beamter gewählt. Da diese Vielfalt hier nicht darzustellen ist, soll wieder die
Berner Regelung als Beispiel dienen.
Die Berner Notarausbildung ist sehr ähnlich strukturiert wie
die Anwaltsausbildung. Grundvoraussetzung ist neben einem reinen Strafregister
und der Handlungsfähigkeit ein Juraabschluss an einer Schweizer Hochschule.
Danach muss eine zweijährige praktische Ausbildung absolviert werden, davon
mindestens 18 Monate in einem Notariatsbüro und 3 Monate in einem Grundbuchamt.
Nach der praktischen Ausbildung folgt die Notariatsprüfung.
Deren schriftlicher Teil besteht aus der Abfassung zweier notarieller Urkunden
und eines Urteils in einer Zivil-, Verwaltungsrechts- oder Strafsache, wofür
jeweils sechs Stunden Zeit ist. Die mündlichen Prüfungen dauern jeweils 20
Minuten und befassen sich a) Notariatsrecht und notariellen Geschäften; b)
Immobiliarsachenrecht mit Einschluss des Grundbuchrechts; c) bernischem Staats-
und Verwaltungsrecht mit Einschluss der Verwaltungsrechtspflege; d)
Strafprozessrecht; e) Zivilprozessrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht; f)
Steuerrecht mit Einschluss des interkantonalen Steuerrechts; g) eheliches
Güterrecht, Erbrecht. Außerdem muss eine zweistündige Prüfung in
Buchhaltung abgelegt werden.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, bekommt das bernische
Notariatspatent und hat damit einen Anspruch auf die Erteilung der
Berufsausübungsbewilligung, die ihm gestattet, öffentliche Urkunden zu
errichten.
Link:
Verordnung
über die Notariatsprüfung
|
|